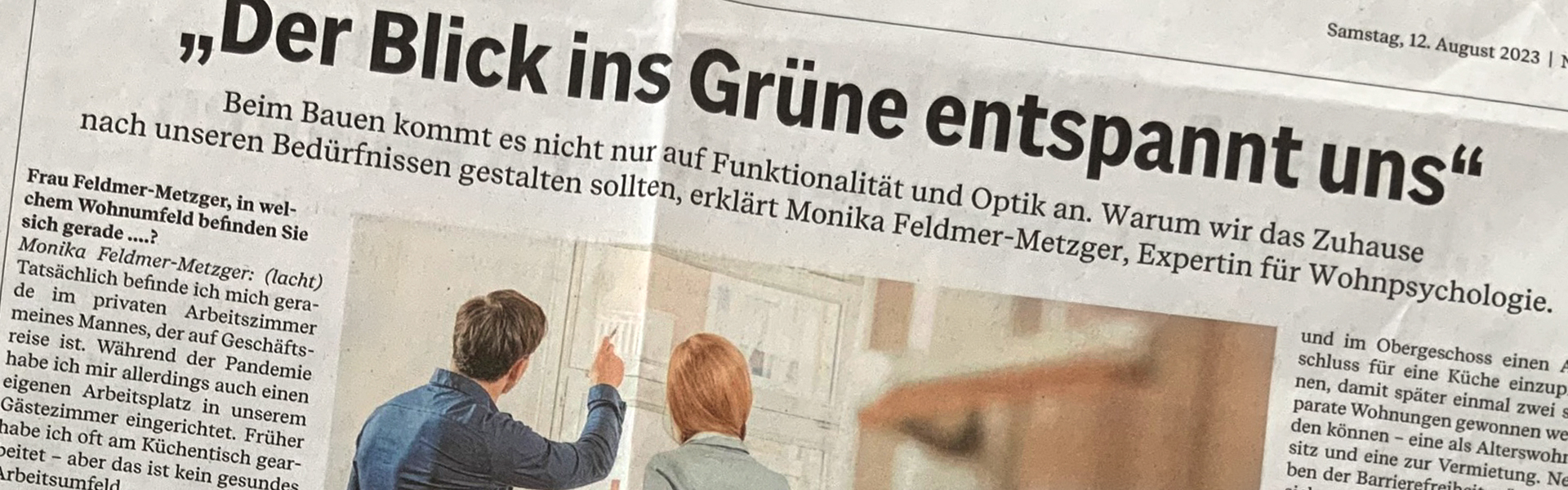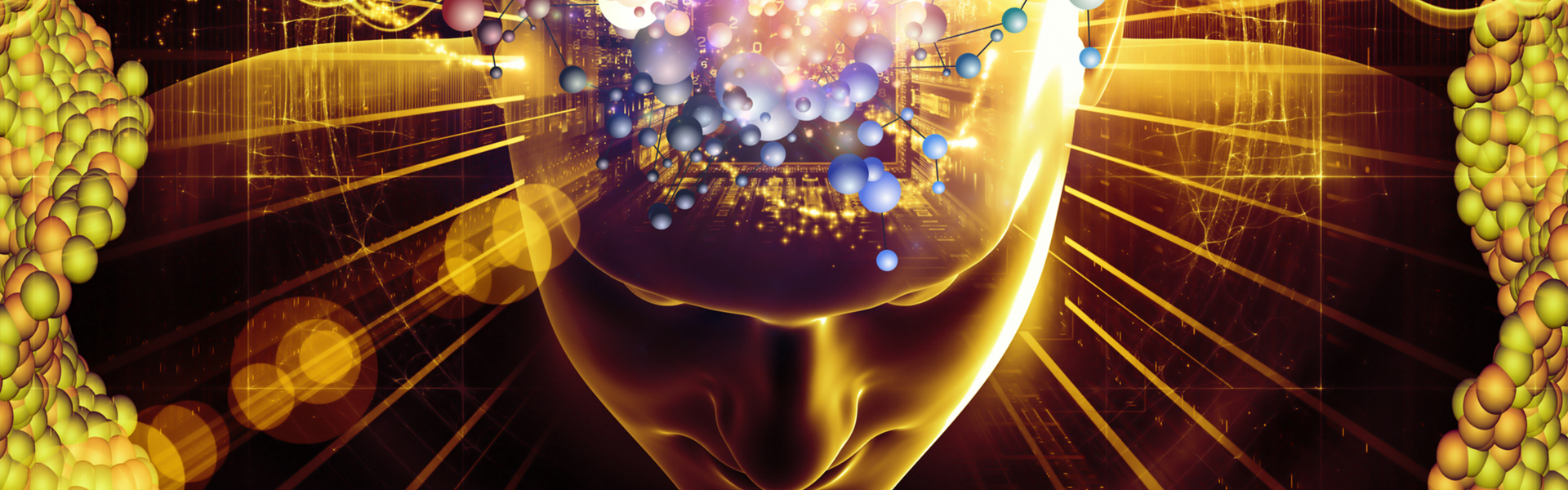Beim Bauen kommt es nicht nur auf Funktionalität und Optik an. Warum wir das Zuhause nach unseren Bedürfnissen gestalten sollten, durfte ich kürzlich in einem Interview mit der Augsburger Allgemeinen – geführt von Paula Binz – erklären:
Frau Feldmer-Metzger, in welchem Wohnumfeld befinden Sie sich gerade ….?
Tatsächlich befinde ich mich gerade im privaten Arbeitszimmer meines Mannes, der auf Geschäftsreise ist. Während der Pandemie habe ich mir allerdings auch einen eigenen Arbeitsplatz in unserem Gästezimmer eingerichtet. Früher habe ich oft am Küchentisch gearbeitet – aber das ist kein gesundes Arbeitsumfeld.
Warum das?
Wenn es möglich ist, sollten Arbeits- und Wohnbereiche räumlich voneinander getrennt sein. Ansonsten kann es schwerfallen, sich bei der Arbeit zu konzentrieren und nach der Arbeit abzuschalten. Diese Trennung ist besonders im Schlafzimmer wichtig. Selbst, wenn da nur Bürounterlagen lagern oder der Korb mit der ungewaschenen Wäsche steht, kann das den Schlaf beeinträchtigen.
Die Pandemie hat uns wohl allen gezeigt, wie entscheidend der Wohnraum für die eigene Stimmung ist. Welche Bedürfnisse spielen dabei eine Rolle?
Wir halten uns zu fast 90 Prozent unseres Alltags in Gebäuden auf. Daher lohnt es sich für jeden, zu hinterfragen, ob ich mich in dem Wohn- und Arbeitsumfeld wohlfühle. Besonders in unserem Zuhause spielt das Bedürfnis nach Sicherheit, Geborgenheit und Privatsphäre eine tragende Rolle. Hinzu kommt außerdem der Wunsch nach Sozialkontakten und ein Bezug zur Natur.
Und wie kann Architektur diese Bedürfnisse erfüllen?
Um die Privatsphäre zu schützen, sollten etwa die Balkone oder Terrassen nicht zu exponiert liegen – sowohl visuell als auch akustisch. Außerdem können bodentiefe Fenster problematisch werden. Besonders in Neubaugebieten liegt dieses Element im Trend, doch in der Praxis ziehen viele Bewohner dann doch meistens die Vorhänge zu. Aber auch innerhalb der Wohnung sollte die Privatsphäre respektiert werden können. Besonders in Familien haben oftmals nicht beide Elternteile eine Rückzugsmöglichkeit. In Zeiten von Homeoffice und Homeschooling ist das aber essenziell geworden. Sozialkontakte sind für uns Menschen zwar enorm wichtig, aber sie sollten im häuslichen Umfeld regulierbar sein.
Nun können es sich aber nicht alle Menschen leisten, ein Haus oder eine Wohnung so zu bauen, dass sie über die Raumaufteilung genau bestimmen können. Wie lässt sich auch mit wenig Geld für Geborgenheit und Erholung sorgen?
Das Gefühl von Geborgenheit lässt sich über viele kleine Aspekte herstellen. Bestenfalls sollte die Wohnung nicht nur aus weißen Wänden und weißen Möbeln bestehen. Stattdessen strömen natürliche Materialien und Farben Wärme aus. Es ist psychologisch nachweisbar, dass besonders ein Blick ins beziehungsweise aufs Grüne entspannt. Wer keine Natur vor dem Fenster hat, der kann mit Zimmerpflanzen oder auch mit Naturbildern nachhelfen. Es lässt sich effektiver arbeiten, wenn der Blick beim Arbeiten auch mal vom Bildschirm weg auf etwas Grünes schweift. Im privaten Kontext können außerdem verschiedene Lichtquellen wie etwa dimmbare Lampen, Stehlampen oder Kerzen für Geborgenheit und Entspannung sorgen.
Und was ist, wenn ich zu Hause zu Chaos statt Ordnung neige?
Wenn zu Hause Chaos herrscht, kann das unbewusst zur Reizüberflutung und damit zu Stress führen, weil auf das Gehirn viele verschiedene Eindrücke einprasseln. Das kann aber auch passieren, wenn die Wohnung allgemein sehr vollgestellt ist oder ich zum Beispiel viele offene Regale habe. Das Reizniveau sollte daher stimmen: nicht zu kahl wie in Wohnmagazinen, aber auch kein buntes Durcheinander.
Die Architektur und Grundrissgestaltung liegt allerdings oft nicht in unserer Hand. Haben Bauherren denn die menschlichen Wohnbedürfnisse im Blick?
Meiner Meinung nach wird beim Bauen zu wenig auf diese psychologischen Aspekte geachtet. Vielen Bauinvestoren geht es nun mal in erster Linie darum, möglichst viele Quadratmeter zu verkaufen. Es sollte aber nicht derjenige den Zuschlag bekommen, der am meisten Geld zahlt, sondern die Baugemeinschaft oder Genossenschaft, die das beste und sozial nachhaltigste Konzept vorlegt. Damit meine ich, dass sich dort verschiedene Generationen auf eine möglichst lange Dauer wohlfühlen können. Selbst Stararchitekten wie Zaha Hadid achten bei der Planung nicht ausreichend auf die Bedürfnisse der zukünftigen Bewohner – und müssen das teuer büßen. Für fast 10 Millionen Euro hat Hadid in Wien eine Wohnanlage bauen lassen, die nun verwaist, weil die meisten Mieter nach kurzer Zeit wieder ausgezogen sind. Und zwar deshalb, weil die Wohnbedürfnisse nicht erfüllt wurden.
Verändern sich die Wohnbedürfnisse mit dem Alter?
Auf jeden Fall. Es gibt nicht einen Grundriss, der für alle Lebensphasen passt. Wer selbst bauen möchte, sollte daher berücksichtigen, wie sich der Wohnraum im Alter anpassen lassen könnte. Es kann sinnvoll sein, im Erdgeschoss ein Badezimmer und im Obergeschoss einen Anschluss für eine Küche einzuplanen, damit später einmal zwei separate Wohnungen gewonnen werden
können – eine als Alterswohnsitz und eine zur Vermietung. Neben der Barrierefreiheit wünschen
sich viele Senioren möglichst viel Selbstbestimmung. Daher ist es im Alter umso wichtiger, zentral und gut angebunden an Einkaufsmöglichkeiten und eine ärztliche Versorgung zu wohnen. Außerdem werden Sozialkontakte im unmittelbaren Umfeld immer wichtiger. Ich beobachte es selbst, dass für viele Ältere das Einfamilienhaus zur Belastung wird. Wer stattdessen in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus zieht, der kommt leichter in Kontakt mit den Nachbarn und kann zudem von gemeinschaftlich genutzten Räumen oder einem Garten profitieren.
Wie sieht für Sie das Wohnen der Zukunft aus?
Ich möchte Einfamilienhäuser nicht schlechtreden, aber ich denke, dass dieses Wohnkonzept keine große Zukunft hat, nicht zuletzt aus ökologischen Aspekten. Es scheint für jüngere Generationen auch gar nicht mehr so erstrebenswert, da sich viele nicht mehr fest an einen Standort binden möchten und nun andere Bedürfnisse eine wichtigere Rolle spielen. Etwa eine zentrale Lage und eine gute Anbindung. Das trifft sich gut, mit dem Ziel vieler Kommunen, die Ortskerne wiederzubeleben. Durch den früheren Trend, Häuser auf der grünen Wiese zu bauen, kam es zum sogenannten Donut-Effekt: Die Ränder von Kommunen werden immer größer, während die Zentren verwaisen. Diesem Trend gilt es nun, entgegenzuwirken. Dabei werden auch Genossenschaftsmodelle, Co-Housing oder Gemeinschaftsgärten eine wichtige Rolle spielen.
Interview mit Paula Binz von der Augsburger Allgemeinen , Foto von Christin Klose